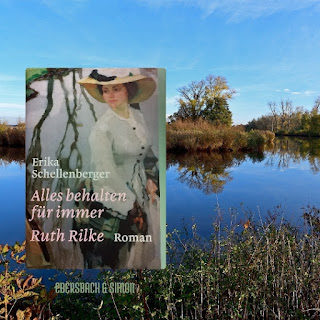Heute erscheint endlich "TOXIN" von Kathrin Lange und Susanne Thiele und die Blogtour, deren Verlauf ihr gerne an Hand obiger Auflistung rekapitulieren könnt, findet auf meinem Blog ihr Finale.
Wir gehen in medias res und begegnen einem in vielerlei Hinsicht gefährlichen Erreger öffentlichen Ärgernisses: Bacillus anthracis.
Noch vor einem halben Jahrhundert war Milzbrand, auch Anthrax genannte, eine häufige Erkrankung. In der Gegenwart kennen die großen Industrieländer die Krankheit nicht mehr, wenngleich sie insbesondere in vielen Ländern um das Mittelmeer und in den ehemaligen Ostblockstaaten immer noch auftritt.
Milzbrand
ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien, und zwar die
Stäbchenbakterien Bacillus anthracis verursacht wird. Der
Begriff Milzbrand geht dabei auf die vergrößerte und verbrannt
aussehende Milz zurück. Die Bezeichnung „Anthrax“ leitet
sich aus dem griechischen
Wort für Kohle her,
die im Deutschen als Anthrazit bekannt ist.
In
der Regel sind Weidetiere wie Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen
betroffen. Allerdings kann die Krankheit bei engem Kontakt durchaus
auch auf den Menschen übertragen werden.
Der
Erreger ist weltweit, aber vor allem in warmen Regionen wie
Lateinamerika, Asien und Afrika zu finden. Er kommt im Boden und vor,
bildet giftige Sporen und reduziert auf diese Art und Weise seine
Lebensfunktionen auf ein Minimum, wodurch es ihm möglich ist, über
Jahre hinweg zu überleben. Übertragen wird er über das Futter.
Eine spezielle Eiweißkapsel
versetzt ihn in die Lage, den
tierischen und menschlichen Abwehrmechanismen zu entgehen. Selbst im
Fall seiner Vernichtung bildet das Bakterium noch Giftstoffe, welche
an den Organismus weitergegeben werden und den Blutgefäßen Schaden
zufügen, wodurch eine „Passage“ erfolgt. Die führt zu
Entzündungen und Blutungen und mithin Schwellung des betroffenen
Gewebes wie Haut, Lunge oder Darm.
Die
Infizierung des Menschen ist auf vier verschiedenen Wegen möglich,
wobei eine Übertragung von Mensch zu Mensch bislang nicht
dokumentiert wurde.
Bei
der häufigsten Form, dem Hautmilzbrand, dringen Sporen in kleinere
Verletzungen der Haut in den Körper ein. Beim Lungenmilzbrand
infiziert sich der Organismus über die Atemwege. Ein Darmmilzbrand
entsteht über die Nahrungsaufnahme, beispielsweise durch rohes
Fleisch und unbehandelte frische Milch. Schließlich kann der
sogenannte Injektionsmilzbrand bei
Heroinkonsumenten vorkommen, wenn die Drogen durch Milzbrandsporen
verseucht sind.
Im
Krankheitsverlauf zeigt Milzbrand
zunächst meist grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf- und
Gliederschmerzen. Dann folgen oft weitere schwerere Symptome, und die
Krankheit kann trotz Behandlung zum Tod führen.
Beim
Hautmilzbrand entstehen kleine Hautknoten, Schwellungen und Blasen,
die in schorfbedeckte Geschwüre übergehen. Während Lungenmilzbrand
nach anfänglichen Atembeschwerden und trockenem Husten mit Lungen-
und Herz-Kreislauf-Versagen einhergehen
kann, leiden Betroffene beim Darmmilzbrand in der Regel unter
Bauchschmerzen, Übelkeit und Fieber, wobei hier bei Verschlimmerung
unter anderem Durchfall, blutiges Erbrechen und ebenfalls
Herz-Kreislauf-Versagen folgen können.
Injektionsmilzbrand
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen starke Schwellungen
an der Injektionsstelle bekommen. Weitergehende Entzündungen und
andere schwere Verläufe führen hin zum Tod.
Milzbrand ist eine schwerwiegende
Infektionskrankheit, so dass in jedem Falle ein Arzt aufgesucht
werden sollte. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung mit
Antibiotika wirken sich sehr positiv auf den Verlauf der Erkrankung
aus.
Als
einzige wirksame Vorbeugung kann allein Impfen in Betracht gezogen werden.
Trotzdem ist Milzbrand – auch in Europa – nicht völlig besiegt.
Außerdem
droht eine andere Gefahr. Bacillus anthracis eignet sich hervorragend als
biologische Waffe, die mit wenig Aufwand durch die Keime verheerende Wirkung
erzielen kann …
--- Fortsetzung folgt ---
Was, wenn eine jahrhundertealte Seuche aus der Arktis zurückkehrt?
Als
in Berlin Obdachlose an Milzbrand sterben, ist
Wissenschaftsjournalistin Nina Falkenberg alarmiert. Die Fälle erinnern
an ein Ereignis in Alaska vor 10 Jahren, als das Auftauen des
Permafrostbodens einen tödlichen Erreger freisetzte. Ebenfalls in Alaska
verschwindet Ninas Freund, der Milzbrand-Forscher Gereon Kirchner. Nina
bittet ihren Bekannten Tom Morell, dorthin zu reisen und
herauszufinden, was passiert ist. Schon kurz nach Toms Ankunft taucht in
einem Eistunnel eine Frauenleiche auf. Ist Gereon schuld an ihrem Tod?
Hat er gar mit dem qualvollen Tod der Obdachlosen in Berlin zu tun?
Während Tom und Nina versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, müssen sie
begreifen, dass sie gegen einen sehr viel mächtigeren Gegner kämpfen,
als sie dachten ... (Quelle: Verlag)
*Werbung*
Erschienen ist der Roman bei Lübbe Belletristik. Die Blogtour wurde organisiert von den Autorinnen.